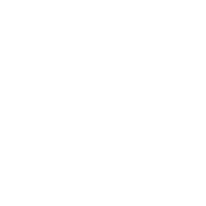Herzlich willkommen im reichhaltigen Durcheinander der Debatte um die Zukunft der Arbeit! Oder haben Sie den roten Faden gefunden?
Ich gestehe ein: Unter all dem, was es für das Projekt „Arbeit 4.0“ zu beackern gibt, verwundert sein Fehlen kaum. Außerdem scheinen die Räder immer schneller zu laufen und stetig neue Werkstücke heranzukarren. Wer könnte da den Überblick behalten?
Es gibt eine, die behauptet zu wissen, wo der Anfang ist:
nämlich bei Arbeit selbst. Vorstellig wird – gestatten – die Philosophie. Sie prahlt ja bekanntlich gern damit, auch im größten Durcheinander den Über- und Unterblick zu behalten. Tatsächlich hilft, so werde ich zeigen, der gern kritisierte philosophische Begriffsfetischismus im Falle von Arbeit und der Frage nach ihrer Zukunft nicht nur weiter; er ist derart erhellend, dass sich, lässt man sich wirklich auf ihn ein, eine anschluss- und mithin zukunftsfähige Beschreibung der Herausforderungen an Arbeit finden lässt.
Eine reizende Unbekannte namens Arbeit
Denn: Nicht nur die Zukunft von Arbeit, wie wir sie kennen, ist in ihren gegenwärtigen Wandel höchst nebulös. Eine mindestens ebenso große Unbekannte ist Arbeit selbst, weshalb die meisten der derzeit kursierenden Prognosen, wie es mit ihr und unserer Arbeitsgesellschaft künftig weitergehen kann, wird und soll, am Gaumen der verständnis- und gestaltungswilligen Gesellschaftstheoretiker*in einen orakeligen Nachgeschmack hinterlassen.
Zugegebenermaßen muss sich die gegenwärtige philosophische Debatte um Arbeit den gleichen Vorwurf gefallen lassen: Auch sie hat sich in den letzten Jahrzehnten an einem belastbaren Arbeitsbegriff buchstäblich die Zähne ausgebissen und dabei Kräfte wie Potenziale vergeudet.
Nun steht sie zahnlos und mit Beißhemmung vor den nicht mehr zu ignorierenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen des sich beschleunigenden Wandels und kann in diesem Zustand ebenfalls nicht adäquat zu einem problem- und lösungsorientierten Verständnis dieser Herausforderungen beitragen.
Verständnis, darum muss es allen Blicken, die sich auf die Zukunft der Arbeit richten, zuallererst gehen: Um ein hierfür endlich aneignungsfähiges Verständnis von Arbeit selbst und der mit ihr verbundenen Wandlungsprozesse, die sozial, wirtschaftlich und auch politisch angestachelt und mithin nur so im Sinne gelingender Lebensführung zu lenken sind.
Ein solches ist die Voraussetzung einer jeden nicht bloß utopischen Beschreibung oder Idee von der Zukunft der Arbeit. Wollen wir absehen, wo es hingeht mit Arbeit und unseren Arbeitsgesellschaften, müssen wir zunächst verstehen, was uns Arbeit überhaupt (noch) bedeutet.
Arbeit verstehen statt Arbeit begreifen
Nicht übersehen werden darf dabei, dass Arbeit und dann freilich auch ihre Zukunft ein gemeinsames soziales, wirtschaftliches und schließlich politisches Projekt ist und immer schon war. Deshalb lässt sich das, was Arbeit ist, eben nicht begrifflich fixieren.
Man erahnt jetzt immerhin, wie anspruchsvoll, aber auch wie erhellend die Antwort auf die Frage „Was ist Arbeit?“ gerade im Hinblick auf die hier behandelten Problemstellungen ist. So elementar wie entscheidend ist die Feststellung, dass Arbeit keine natürliche, eigengesetzliche Entität ist, sondern eine artifizielle; sie ist eine vom Menschen zu bestimmten Zwecken gemachte, gestaltete und entwickelte Praxis und – in komplexen Gesellschaften wie unseren Arbeitsgesellschaften – Institution.
In diesem Sinne ist sie ein hochkomplexes Konstrukt und ihre Zukunft kann einigermaßen verlässlich nur ausgemalt werden in einem Bild, das diesen Facettenreichtum auch wirklich und vollständig zeigt.
An sich lässt Arbeit sich nicht begreifen,
…genauso wenig lässt sich losgelöst von ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Rahmung so viel über sie sagen, dass sich ein anschlussfähiges Bild von ihr ergäbe. Zuallererst Instrument von Subsistenzsorge und Bedürfnisbefriedigung, muss Arbeit sich mit den Anforderungen daran notwendigerweise wandeln. Das gilt für ein gesellschaftlich teilbares und dann praktisch belastbares Arbeitsverständnis aus historischer wie aus soziologischer Perspektive, weil Arbeit als gesellschaftliche Institution stets eng mit dem sozialen Wandel verknüpft ist, der mit gesellschaftlichem Fortschritt einhergeht.
So untersteht das, was eine Gesellschaft auf einer bestimmten Entwicklungsstufe als Arbeit qualifiziert oder von ihr als Instrument der Lebensführung erwartet – was also „gute Arbeit“ und wie sie gestaltet ist und künftig sein soll – immer den gerade jeweils gültigen Erwartungen an gelingende Lebensführung, damit eben auch den aktuell geteilten Wertvorstellungen.
Einigermaßen verlässliche Aussagen über die Zukunft der Arbeit lassen sich demnach nur treffen, wenn man die Entwicklungslinien kennt, die in diese Zukunft führen, und auf ihnen gewissermaßen vorausdenkt.
Deshalb: Zurück in die Zukunft!
Nach der Erkenntnis, dass Arbeit viel mehr ist als die, die sie oberflächlich betrachtet zu sein scheint, müssen ihre heutigen Vordenker*innen auch die Herausforderung dieses zweiten Befunds annehmen, der da lautet: Zurück in die Zukunft! Der Blick auf vormalige Narrative von Arbeit und auf ihren heutigen Status Quo lohnt nicht nur, er ist unumgänglich.
Dann wird nämlich auch klar, welche gerade auch problematischen, d. h. falschen oder praktisch etwa prekäre Arbeits- und Lebensverhältnisse verursachenden Narrative oder Aneignungen von Arbeit entscheidend für unser heutiges und künftiges Bild von ihr waren und sind.
Arbeit für ein gutes Leben
Möglicherweise kann Arbeit, wenn wir sie richtig verstehen und entsprechend gestalten, viel besser und ganz anders zu einem guten Leben beitragen; möglicherweise besitzt sie bislang völlig unentdeckte und mithin unverwirklichte Potenziale.
Diese sichtbar zu machen ist zuerst eine theoretische Aufgabe, ihre Lösung aber praktisch höchst interessant und vielversprechend. Gerade jetzt, wo die Anforderungen an Arbeit sich so rasant wandeln, lohnt es sich zu fragen, was sie unter welchen Bedingungen wie leisten kann und wie wir sie dafür gestalten, organisieren und verteilen müssen.
Neue Werte – neue Arbeit
Diese Bedingungen unterliegen etwa seit den 1980er Jahren einem Wertewandel, in dessen Mitte ein ganz bestimmtes, allerdings sehr mangelhaftes Verständnis von Arbeit steht; auch dieses gilt es zu berücksichtigen. Es trägt jene Entwicklungen, die wir gegenwärtig als Subjektivierung, Entgrenzung oder Flexibilisierung von Arbeit diskutieren; bei denen wir uns noch nicht so ganz sicher sind, ob und wie sie die Zukunft unserer Arbeit bestimmten werden oder sollten und warum eigentlich oder auch nicht.
Ausgerechnet dieser Wertewandel nämlich, dessen Rekonstruktion für ein zukunftsfähiges und zukunftsverständiges Arbeitsverständnis so entscheidend ist, ist fatalerweise der blinde Fleck der gegenwärtigen Debatte um die Zukunft der Arbeit:
Wo diese in erster Linie Digitalisierung, Automatisierung, Migration und den demographischen Wandel als Herausforderer und als die Anlässe einer Neubestimmung von Arbeit vorführt, unterbestimmt sie den viel grundlegenden und für Prognosen der Zukunft der Arbeit entscheidenden Wandel der gesellschaftlichen Konfiguration; d. h. den Wandel der gesellschaftlich geteilten Wertvorstellungen und Ziele, aber auch der Bedingungen und Formens unseres Zusammenlebens und Fortschreitens.
Flüchtig sei unsere Moderne, urteilt der Philosoph und Soziologe Zygmunt Baumann; er charakterisiert damit den Übergang westlicher Gesellschaften von materialistischen zu postmaterialistischen Wertvorstellung und schließlich Aneignungen.
Digitalisierung verändert Leben, Zusammenleben und Arbeit
Tatsächlich ist dieser Wandel kultureller Natur und strahlt weit darüber hinaus. Er vollzieht sich auch und gerade an Arbeit, weil kritische Auseinandersetzungen mit bestimmten Formen der Arbeitsgestaltung ihn bis heute anfeuern.
Zum Verständnis verhilft wieder die rückwärtige Verlängerung der Linie unseres heutigen Narrativs von Arbeit in seine kritische Quelle hinein: Zwar hatten die Strukturen der alten Lohnarbeitsgesellschaft (Robert Castel) der Mehrheit ihrer Mitglieder eine relativ gute und stabile soziale Absicherung ermöglicht, jedoch zum Preis des weitgehenden Ausschlusses von Frauen aus der Erwerbsarbeit und einer Enge und Inflexibilität, die kaum Raum für Kreativität, eigene Bedürfnisse oder Selbstverwirklichung bot.
Wo also gesamtgesellschaftlich existenzielle Nöte durch das Erreichte in den Hintergrund traten, konnte sich jener Wertewandel vollziehen: Als Prozess der Individualisierung (Ronald Inglehart), weg von Überlebens- hin zu Selbstverwirklichungswerten, mit entsprechend veränderten Ansprüchen an Arbeit und Arbeitsgestaltung.
Unverständnis als folgenschweres Problem
Tatsächlich arbeiten wir heute in vielen und immer mehr Bereichen anders als früher; und das ist nicht nur eine Folge von Automatisierung und Digitalisierung, sondern auch unserer veränderten Ansprüche an Arbeit und gelingende Lebensführung. Die Probleme und Chancen dessen lassen sich nur ermessen, wenn man beides zusammen denkt. So haben die neuen Arbeitsformen Zusammenarbeit an manchen Stellen gestärkt, an anderen geschwächt.
Das gleiche gilt für den Einfluss des Einzelnen auf seine Arbeit und deren Bezüge oder die Verantwortung für die eigene Erwerbsbiografie. Als Teil dessen, was wir „Arbeit 4.0“ nennen, muss unbedingt auch jener kulturelle Wandel gesehen werden und dass mit ihm die tradierten Beschreibungen und Auffassungen sozialer Kooperation und unserer Ansprüche an Arbeit nicht mehr gelten. Aber welche gelten dann?
Geboten ist auch hier eine gründliche, kritische Analyse.
Denn fatalerweise sind gegenwärtig gerade jene neuen Arbeitsformen heikel oder zeitigen gerade jene arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Instrumente prekäre Verhältnisse, die den neuen Werthaltungen und Ansprüchen scheinbar gerecht werden. So sind etwa Freelancer*innen oder Crowdworker*innen oft aus der mit Arbeit verbundenen sozialen Absicherung ausgeschlossen und müssen für ihre Arbeitsmittel selbst sorgen. Ähnliche und weitere Nachteile haben Leiharbeiter*innen und Teilzeitbeschäftigte.
Solche Formen der Arbeitsorganisation nehmen Errungenschaften der Lohnarbeitsgesellschaft zurück und lösen den neuen Selbstverwirklichungsanspruch an Arbeit gerade nicht ein; sie sind das Gegenteil eines selbstbestimmten Tätigseins, das sich mit den anderen Bereichen des Lebens und den individuellen Ansprüchen daran vereinbaren lässt. Das ist uns viel zu selten bewusst.
Dieses Phänomen, auf das ich hier nur ein Schlaglicht werfen kann, ist Folge und Teil einer allgemeinen Subjektivierung unserer Arbeitsgesellschaft, die außerdem eine ganz bestimmte Form der Vermarktlichung von Arbeit so befeuert, dass Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung dem beschriebenen Wertewandel versteckt zuwiderlaufen.
Was kann Arbeit leisten?
Aber es ist eben ganz besonders auch eine Folge unseres Unverständnisses von Arbeit; davon, dass wir nicht wissen, was Arbeit ist, welche Stellung ihr wie als Institution und Praxis zukommt, was sie für unsere Lebensführung und unser Zusammenleben leisten kann und welche Ansprüche wir dann berechtigterweise an Arbeitsgestaltung vorbringen können.
Dies zu durchdringen ist anspruchsvoll, aber lohnenswert und vor allem eine inter- und transdisziplinäre Aufgabe. Es ist schlechterdings die allererste Aufgabe, die wir angehen müssen auf dem Weg in eine gelingende Zukunft unserer Arbeit, in der sie sich selbst, d. h. ihren Potenzialen und unseren Ansprüchen an sie, gerecht wird. Damit wir wissen, wovon wir reden.
972 mal gelesen