Arbeiten 4.0 ist ein alter Hut. Begrifflich wird New Work oft in Verbindung gebracht mit den Arbeiten von Frithjof Bergmann, der schon im Jahr 1977 die ersten Grundlagen für eine neue Art, Arbeit und Leben zu vereinen, verschriftlicht hat. Ganz kurz ist seine Vorstellung, dass die Neue Arbeit aus den drei Teilen 1/3 Erwerbsarbeit, 1/3 High-Tech-Self-Providing (Selbstversorgung) und smart consumption und 1/3 Arbeit, die man wirklich, wirklich will, bestehen sollte.
Aber alleine der Wunsch, endlich „SINNvoller“ zusammenzuarbeiten, wird eine Veränderung der Arbeitswelt nicht befördern. Es müssen handfeste Zahlen und Rahmenbedingungen hinzukommen, „hard facts“, die einen Wandel einleiten.
Sozialwirtschaft als Wirtschaftsfaktor
Die Sozialwirtschaft ist als ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor in Deutschland anzusehen. So zeigt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, dass es sich um den größten Wirtschaftsbereich in Deutschland handelt: Auch wenn die Zahlen aufgrund der Heterogenität der Organisationen nicht leicht zu generieren sind, lässt sich von etwa 4,6 Millionen Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen ausgehen. Tendenz übrigens – im Gegensatz zu vielen anderen Branchen – eindeutig steigend.
Und zur Wertschöpfung der Sozialwirtschaft schrieb die Friedrich-Ebert-Stiftung im Jahr 2014: „Mittlerweile erwirtschaftet die Sozialwirtschaft rund sieben Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in Deutschland. Im Vergleich dazu liegt der Anteil des Fahrzeugbaus bei unter vier Prozent und der des Maschinenbaus bei rund drei Prozent.“
Aber bezogen auf die Arbeit in den Organisationen der Sozialwirtschaft?
Da herrscht mehr oder weniger das berühmte Schweigen im Walde! Warum ist das so? Will man in der Sozialwirtschaft nicht darüber reden? Oder kann man nicht?
In meinen Augen sind fünf Gründe wesentlich, die dazu führen, dass eine Diskussion über die Arbeitsbedingungen in den Sozialen Organisationen kaum stattfindet:
-
Die Sozialwirtschaft hinkt den Entwicklungen hinterher
Ein Blick auf die Finanzierung sozialer Arbeit macht deutlich, dass Organisationen der Sozialwirtschaft im Wesentlichen abhängig sind von staatlichen Zuwendungen. Inzwischen nimmt die Notwendigkeit, einen „Finanzierungsmix“ aus unterschiedlichen Quellen zu gestalten, zwar einen immer größeren Raum ein (bspw. Spenden, Verkauf von Produkten, Fundraising…). Der Großteil der Finanzierung besteht jedoch aus staatlichen Zuschüssen. Das hat Folgen: So steht die Organisation als „Leistungserbringer“ einerseits in einer Co-Produktionsbeziehung zum Klienten und andererseits in einer Kundenbeziehung zum Leistungsträger. Der Fachbegriff ist das „Leistungsdreieck der Sozialwirtschaft“.
Für Organisationen der Sozialwirtschaft folgt daraus aber, dass die Bedürfnisse der Nutzer sozialer Dienstleistungen, der Klientel, nur begrenzt Ausgangspunkt für innovatives Handeln der Organisation sein können. Vielmehr stellt sich die grundlegende Frage, ob der Leistungsträger die anfallenden Kosten übernimmt bzw. ob eine gesetzliche Grundlage zur Kostenübernahme besteht. Aus organisationaler Perspektive führt dies zu einer reaktiven Grundhaltung der Organisation: Bevor nicht sichergestellt ist, dass die Finanzierung bspw. einer neuen sozialen Dienstleistung sichergestellt ist, wird der Versuch der Umsetzung dieser neuen Dienstleistung erst gar nicht übernommen.
Für Arbeit 4.0 folgt aus der reaktiven Grundhaltung, dass Versuche, die Arbeit in der Organisation mit ihren Prozessen neu zu gestalten, ebenfalls nicht unternommen werden. Ja, es mag hier Ausnahmen geben, aber das Gros der Organisationen steht hier noch sehr am Anfang. Viel eher bin ich der Auffassung, dass „Management-Methoden“, die in erwerbswirtschaftlichen Organisationen aufgrund sich verändernder Umweltbedingungen schon wieder „aus der Mode“ gekommen sind, in Organisationen der Sozialwirtschaft zeitverzögert eingeführt werden. Zu nennen sind bspw. Qualitätsmanagement-Anforderungen, die von den Organisationen, zu Teilen aber auch vom Gesetzgeber, so strikt ausgelegt sind, dass der Zweck der Methode – die Sicherung bzw. Steigerung der Qualität – zugunsten von überbordenden Dokumentationspflichten aus dem Blick gerät.
-
Die Beschäftigten kümmern nicht um die Organisation
Als weitere Hürde wird deutlich, dass sich die Professionellen in der Sozialwirtschaft vornehmlich um die Klientel kümmern. Die Organisation als Fokus der Beschäftigten, aber auch der Führungskräfte, nimmt einen verhältnismäßig kleinen Stellenwert ein. Organisationale Aspekte insgesamt und damit auch die Notwendigkeit zur Weiterentwicklung der Organisationen werden vernachlässigt. Aus der Perspektive der Mitarbeitenden, die oftmals eine hohe Identifikation mit den Bedürfnissen der Klientel aufweisen, ist dieses Vorgehen nachvollziehbar.
Als Folge davon kann jedoch vermutet werden, dass Organisationen der Sozialwirtschaft eine wenig innovationsaffine Unternehmenskultur aufweisen, da die Notwendigkeiten zur Weiterentwicklung der Organisation nicht im Bewusstsein der Mitarbeitenden verankert ist. Organisation ist, so wie sie ist! Neue Denkmöglichkeiten von Zusammenarbeit ergeben sich entsprechend nicht aus der Mitarbeiterschaft heraus.
Bedeutsam ist dies insofern, als dass in der täglichen Arbeit der Professionellen eine grundlegende Notwendigkeit zur Selbstorganisation besteht. So sind die Sozialarbeitenden immer gefordert, schnelle, jeweils situationsspezifische, eigene Entscheidungen zu treffen. Die Strukturen, Regeln und Vorgaben der Organisation werden jedoch – teilweise sehr verständlich – als hinderlich betrachtet.
-
Die Führungskräfte haben „den Laden im Griff“
Neben den „Nutzern“ der angebotenen Dienstleistungen sind die Organisation in einer Abhängigkeitsbeziehung zu den Leistungsträgern, den meist aus politischem Umfeld stammenden Geldgebern (Kommunen, dem Land etc.). Darüber hinaus sind viele der Dienstleistungen gesetzlich klar geregelt, wodurch sich die Organisationen neben dem Politiksystem auch in hohem Maße mit dem Rechtssystem als Umwelt der Organisation auseinandersetzen müssen. Als dritter Pol kommt die Eingebundenheit in Trägerstrukturen zum Tragen. So sind Organisationen der Sozialwirtschaft in zumeist verbindlich geprägte Strukturen (bspw. Caritas-Verbände) eingebunden, die bei organisationalen Entscheidungen zu berücksichtigen sind.
Erwähnenswert ist darüber hinaus, dass Organisationen der Sozialwirtschaft oftmals in Rechtsformen organisiert sind, die als oberste Entscheidungsgremien bspw. Vorstände oder Mitgliederversammlungen haben. Deren – zu Teilen fachfremden – Interessen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Daraus folgt aus der Perspektive der Führungskräfte sozialwirtschaftlicher Organisationen, dass diese in ihrem Führungshandeln eine enorme Komplexität zu bewältigen haben.
Die hohe Komplexität der zu beachtenden Vorgaben, die Vielzahl der involvierten Stakeholder, die Notwendigkeit, moralisch immer einwandfrei zu handeln (hier ist der Druck höher als in erwerbswirtschaftlichen Organisationen, die dies natürlich auch tun müssen) kann dazu führen, dass sich die Führungskräfte vornehmlich mit operativen Führungstätigkeiten befassen. Die Arbeit an der Organisation, die Arbeit an Strukturen und Prozessen, wird vernachlässigt. Daraus resultiert auch eine Vernachlässigung der Frage, wie eigentlich in der jeweiligen Organisation zusammen gearbeitet werden soll.
Ende Teil 1 – Fortsetzung folgt…
1054 mal gelesen



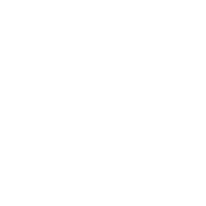

ich bitte um Zusendung des NL, danke
Sehr geehrter Herr Epe!
Ich möchte mich herzlich für diesen Artikel bedanken. Ihre Beschreibung trifft den Nagel auf den Kopf. Auch in Österreich ist es ein großer und wachsender Wirtschaftszweig.
Die Komplexität mit der Arbeitnehmerinnen in ihrer Profession in einem Gemeinnützigen Unternehmen, welches im Auftrag von Jugendwohlfahrten sowohl im mobilen als auch im stationären Kontext arbeitet, ihrer Tätigkeit nachgehen, hält wohl viele Beschäftigte davon ab sich mit möglicher Erneuerung auseinander zu setzen. Die von ihnen beschriebenen Rahmenbedingungen tragen dazu auch wesentlich bei.
Wir befinden uns auf einem Weg der Verregelung und daraus entstehen oftmals als sinnlos empfundene Dokumentationspflichten. Meiner Meinung nach dienen diese ausschließlich dazu die Auftraggeber vermeintlich zu schützen um in den Medien ja keiner Fehler bzw. Unterlassungen bezichtigt zu werden. Diese werden dann in Qualitätsanforderungen verschriftlicht und über alle Bereiche gelegt. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Punkt ist der steigende Leistungsdruck der aufgrund von sogenannten Sparmaßnahmen bzw. Kürzungen der Geldleistungen der öffentlichen Hand. Dies wird von Organisationen als zusätzlicher Druck, speziell bei denen die im Auftrag der öffentlichen Hand als freie Jugendwohlfahrtsträger seit einiger Zeit als „Private Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe“ manche Lähmung in der Innovation verursacht haben könnte.
Die Abhängigkeit von einem Monopolisten um überhaupt zu Aufträge zu gelangen einerseits und die als sogenanntes freies Unternehmertum verkaufte Verwaltung von im Grunde ausschließlich öffentlichen Geldern andererseits, um einen Auftrag der öffentlichen Hand zu erledigen und das von ihnen genannte Leistungsdreieck der Sozialwirtschaft scheinen sich gegenseitig zu behindern.
Aufgaben der Jugendwohlfahrt und damit der jeweiligen Landesregierung oder des Bundes wurden aus Kostengründen von der öffentlichen Hand auf freie Träger übertragen. Finanziert wird alles durch Steuergeld. Innovation ist gut soll aber auf gar keinen Fall Kosten erzeugen um keine Steuergeld zu „verschwenden“.
Dadurch ist auch das Ansehen in der breiten Öffentlichkeit des Berufsstandes des Sozialpädagogin oder Sozialarbeiterin im Inhalt hoch jedoch in der finanziellen Abgeltung der Leistung gering und das schlägt sich im Selbstbewusstsein sowie im Selbstvertrauen nieder obwohl es einer Langjährigen Ausbildung an einer Fachhochschule bedarf. Meines Erachtens bedarf es einer Aufwertung innerhalb der Gesellschaft und einer deutlicheren Transparenz was an Arbeit wie geleistet wird. Leider können oder wollen sich die meisten Unternehmen oder auch deren Fachverbände offensichtlich keine „Thinktanks“ leisten die sich mit der Vermarktung der Berufe der Sozialwirtschaft in größerem Ausmaß auseinandersetzen. Die sogenannte freie Presse erwies sich bisher in Österreich nicht sehr hilfreich dieser Berufsgruppe breiteren Raum zu geben und die Leistungen entsprechend zu würdigen. Es wird eher bei einem Versagen des Systems auf den Bereich als zu teuer und ineffizient hingewiesen. Es kann ja nicht einmal seinen Auftrag erfüllen, dass es sich dabei um die Arbeit mit Menschen handelt und nicht um genormte Waren aus der industriellen Fertigung wird oftmals einfach übersehen.
Ich bin davon überzeugt, dass es möglich ist Kolleginnen davon zu überzeugen an einer Erneuerung und damit verbundenen positiven Gestaltung der Zukunft mitzuwirken.
Nichts desto trotz gibt es durchaus gute, vorausdenkende Unternehmen sowie Organisationen im Bereich der Sozialwirtschaft die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen und damit in die Zukunft investieren soweit sie es sich leisten können und dürfen.
freundliche Grüße
Penz (Betriebsratsvorsitzender)
Lieber Herr Penz,
das Leben ist hart und das trifft insbesondere auf die öffentliche Internetverbindung zu. Damit entschuldige ich mich für meine verspätete Antwort 😉
Ganz herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung, die ich in den wesentlichen Punkt voll tragen kann. So erschreckt es mich auch, dass versucht wird, der Nichtregelbarkeit in Organisationen der Sozialwirtschaft mit dem Versuch verstärkter Regelung beizukommen. Ein aussichtsloses Unterfangen. Aber ich bin gespannt, wann die Grenze erreicht ist, und die gerade von den Sozialarbeitern propagierte Systemtheorie auch für ihre eigenen Organisationen gelebt wird.
Ebenfalls stimme ich dem steigenden Leistungsdruck zu. Dazu nur kurz: Aufgrund des Fachkräftemangels und der häufig als unattraktiv empfundenen Arbeitsbedingungen drehen sich die Organisationen zunehmen in einem Teufelskreis, aus dem es nur schwer ein – und mit konventionellen Mitteln gar kein – entkommen gibt. Dazu kommt im zweiten Teil noch ein kurzer Abriss.
Bezüglich der Aufwertung des Berufs bin ich ziemlich skeptisch, solange nicht damit begonnen wird, die Problemorientierung gegen eine Perspektive der Lösungsorientierung einzutauschen. Konkret fokussiert sich die Sozialwirtschaft zu sehr darauf, Projekte zu finden, die das Überleben der Organisationen sichern. Sicherlich sinnvoller wäre es aber, sich darauf zu fokussieren, was wirklich nützlich ist für die Nutzer sozialer Dienstleistungen. Erst wenn der Wert der Arbeit auch nach außen sichtbar wird, wird das Ansehen und damit dann auch Bezahlung steigen können.
und abschließend noch einmal meine volle Zustimmung dazu, dass es bereits einige gute Unternehmen gibt, die richtige Wege in dem System gehen.
Freue mich auf Ihren Kommentar zu Teil 2 der Serie 😉
Beste Grüße
Hendrik Epe