Hier gehts zum ersten Teil der Serie.
Einer dieser Pioniere ist Peter F. Drucker, der die Entwicklung moderner Management-Konzepte wie kaum ein Zweiter beeinflusst hat und bereits 1959 die Begriffe „Wissensarbeit“ und „Wissensgesellschaft“ prägte. Drucker erkannte damals, dass die durch die Informationstechnik ausgelöste Wissensexplosion nur durch zunehmende Spezialisierung zu bewältigen ist. Da mit der Ausbreitung von Computern Routinetätigkeiten zunehmend auf Technik übertragen werden, bleibt für Menschen das übrig, was Computer (noch) nicht können. Wertschöpfung, bei der Menschen gebraucht werden, findet damit künftig vor allem bei der Bewältigung von Ausnahmesituationen und immer weniger bei Standardabläufen statt. Damit werden fast alle verbleibenden Arbeiten langfristig intellektuell anspruchsvoller. Zugleich erkannte Drucker, dass Wissensarbeit eine vollkommen andere Art von Management erfordert als industrielle Handarbeit.
Heute sind die meisten Menschen Wissensarbeiter
Drucker definierte: „Ein Wissensarbeiter ist jemand, der mehr über seine Tätigkeit weiß als jeder andere in der Organisation.“ In diesem Sinn sind in den entwickelten Ländern heute die meisten Menschen Wissensarbeiter. Es sind nicht zwangsläufig Wissenschaftler, wir finden diese Experten ihrer eigenen Arbeit heute überall: Arbeiter in der Produktion, die Fertigungsprobleme selbständig lösen; Wartungstechniker, die ihren Arbeitstag selbst planen und viele andere sind heute Wissensarbeiter.
Wissensarbeiter brauchen Organisationen, in denen sie ihr Know-how optimal mit den Kenntnissen anderer Spezialisten verbinden und zu neuem Wissen umsetzen können. Dafür sind hierarchische Organisationen jedoch ungeeignet, weil Wissen nicht hierarchisch strukturiert, sondern situationsabhängig entweder relevant oder irrelevant ist. Ein Beispiel: Herzchirurgen haben zwar einen höheren sozialen Status als etwa Logopäden, doch wenn es um die Rehabilitation eines Schlaganfallpatienten geht, ist das Wissen des Logopäden dem des Chirurgen weit überlegen. Organisationen für Wissensarbeit müssen diesem Sachverhalt Rechnung tragen, denn Entscheidungen sollten dort getroffen werden, wo das Wissen ist.
Das große Dilemma
Hier entsteht das große Dilemma, das für unsere Zeit des Übergangs von der Industrie- zur Wissensgesellschaft kennzeichnend ist: Heute arbeiten solche Wissensarbeiter fast überall, aber meist in Organisationen, die noch immer von Frederick W. Taylors Konzept der „wissenschaftlichen Betriebsführung“ mit strikter Trennung von Entscheidung und Ausführung geprägt sind. Taylor sah den Arbeiter nicht als eigenständig Handelnden, sondern als Teil der industriellen Maschinerie. Wissensarbeiter kennen die Wirkungen dieses Dilemmas: Oft hat man es mit Vorgesetzten zu tun, die über Dinge entscheiden, von denen sie in der Regel weit weniger verstehen als man selbst, die aber – weil sie nun einmal diese Position innehaben – meinen, sagen zu müssen „wo es lang geht“. Die Folgen dieser anachronistischen Zustände sind weit verbreitet: Frust und Demotivation bis hin zur inneren Kündigung – wodurch der deutschen Wirtschaft alljährlich Verluste im dreistelligen Milliardenbereich entstehen –, von seelischen und gesundheitlichen Folgen ganz abgesehen.
Netzwerke statt Hierarchien
Hierarchisch-funktional gegliederte Planstellensysteme, also die klassischen Unternehmensformen, versagen unter den Bedingungen von Wissensarbeit früher oder später zwangsläufig, da sie intern vor allem Anpassung statt Innovation fördern. Betrachtet man Innovation als sozialen Prozess, so sind dies in der Regel Bottom-Up-Prozesse, die sich mit Top-Down-Strukturen prinzipiell schlecht vertragen. In hierarchischen Strukturen wird Macht häufig als Möglichkeit, bessere Argumente zu ignorieren, missbraucht, da innovative Ideen oft als Gefahr für die bestehenden Machtverhältnisse wahrgenommen werden.
Als zeitgemäße Alternative kristallisieren sich derzeit in Wertschöpfungsnetzwerken, vor allem in ungezählten Open-Source-Projekten, neue Formen der Zusammenarbeit heraus, die langfristig nicht nur zu einer neuen Definition von Arbeit führen, sondern die Gesellschaft insgesamt grundlegend umkrempeln werden. Die Open-Source-Praxis entwickelt sich zu einer strukturbildenden Leitidee, ähnlich wie die Praxis des Taylorismus in der industriellen Epoche soziale Verhaltens- und Denkweisen prägte.
Open-Source
Dass die auf freiwilligem Engagement basierenden Open-Source-Kooperationen weltweit verstreuter Menschen in der Lage sind, auch komplexe Produkte auf Weltklasse-Niveau herzustellen, zeigen die Erfolge von Linux, Apache, Firefox, Wikipedia und vielen anderen, die oft schon nach kurzer Zeit ihren kommerziellen Konkurrenten überlegen sind. Bei Open Source geht es aber nicht nur um Software, sondern vor allem um ein soziales Phänomen.
In Open-Source-Gemeinschaften basiert Wertschöpfung auf Wertschätzung und nicht auf Befehl und Gehorsam – die Beteiligten arbeiten selbstorganisiert auf Augenhöhe miteinander. Während traditionell bürokratische Strukturen auf ängstlich gehütetem Herrschaftswissen basieren und Misstrauen, Kontrolle, Opportunismus und Schönfärberei das Klima vergiften, existiert in Open-Source-Strukturen ein anderes Verständnis von geistigem Gemeineigentum. Wie schon der Name sagt, sind die Quellen hier offen; die Menschen sind motiviert und gerne bereit, ihr Wissen und ihre Ideen mit anderen zu teilen, weil ihnen Vertrauen, Respekt, Anerkennung, Fairness und Toleranz entgegengebracht wird. Führungsfunktionen gibt es hier natürlich auch – aber nur vorübergehend auf ein Thema oder Projekt beschränkt und sie beruhen auf Kommunikations- und Sachkompetenz und nicht auf von oben verliehener formaler Autorität. Statussymbole und formale Titel spielen im Netz kaum eine Rolle, hier ist die Brillanz von Ideen und die tatsächliche Leistung relevant und nicht die Größe eines Büros oder Schreibtischs.
Arbeitsgestaltung und Arbeitskultur lernen
Natürlich wird unsere Welt keine Open-Source-Welt werden, aber Unternehmen können von den Open-Source-Communities eine Menge über zeitgemäße Arbeitsgestaltung und Arbeitskultur lernen. Da Wettbewerb immer mehr zum Innovationswettbewerb wird, bestehen durchaus Chancen, dass sich intelligentere Formen der Zusammenarbeit und offene Innovationskulturen langfristig durchsetzen und künftig zu einem neuen Verständnis von Arbeit führen werden. Die junge Generation, die mit Wikis, Blogs und Social Networks groß geworden ist, lebt ohnehin eine neue Kultur des Wissensaustauschs. Viele dieser „Digital Natives“ werden sich nicht mehr in eine graue Sachbearbeiter-Welt einsperren lassen, wo sie zwischen Karriereleitern, Gehaltsgittern, Planstellen und Dienstwegen viel Zeit und Energie mit internen Machtspielen vergeuden. Unsere Unternehmen werden von diesen Internet-Gemeinschaften lernen müssen, weil sie andernfalls diese Generation nicht als kreative Mitarbeiter werden gewinnen oder halten können. Unternehmen, die hingegen zu lange an den überkommenen Arbeitsstrukturen der Industrieära festhalten, werden aufgrund ihrer internen Innovationsbarrieren untergehen.
Teil 3 des Beitrags von Ulrich Klotz wird in den nächsten Wochen publiziert.
2120 mal gelesen



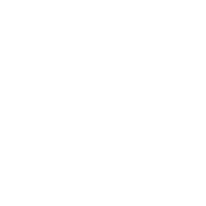

Sehr geehrter Herr Klotz, ich würde mich sehr freuen über ein gemeinsames Gespräch zum Thema CCI (cross-culture individual). Die Schulung zum CCI gibt es für Diplomaten, Entwicklungshelfer und Blauhelme bereits seit 30 Jahren, damit diese trotz Verlust der vertrauten Umgebung in der Lage sind ihre Aufgaben wahrzunehmen. Angesichts der fortschreitenden Globalisierung bin ich der Meinung, dass heute alle Menschen diese Schulung erhalten sollten, um mit der neuen Mehrdeutigkeit am Arbeitsplatz und im Privatleben zurecht zu kommen. Leider ist dies in Europa nicht der Fall. Das möchte ich ändern, das kann ich ändern aber dafür brauche ich Hilfe = Vernetzung in Europa. Mit herzlichen Grüßen,
Imme Gerke