Ich sitze im Büro, also bin ich? Diesen Mythos verbreiten vor allem Konzerne mit allerlei Bespaßungsmaßnahmen, um zu kaschieren, dass das Angestelltendasein immer noch in einem „Gehäuse der Hörigkeit“ stattfindet, wie es die „Wirtschaftswoche“ mit Verweis auf Max Weber beschreibt. Freiheit am Arbeitsplatz sei nur ein anderes Wort für Dressur.
„Die Welt dreht sich schnell und immer schneller, verraten uns die Soziologen, nur im Büro steht alles still. Kein Fortschritt nirgends, weit und breit. Der Mensch hat im vergangenen Jahrhundert den Fernseher erfunden, den Mond besucht und das Genom entschlüsselt, allein sein Angestelltenleben innoviert, das hat er nicht“, so die „Wirtschaftswoche“. Noch immer rieche die Büroluft nach Anonymität und Organisation, nach Funktionalität und Vergemeinschaftung, nach Kreativitätswüste und liniertem Denken:
„Ganz gleich, ob eingepfercht in blickgeschützten Boxen oder lichtdurchfluteten Aquarien, in milchverglasten Vorzimmern oder verschließbaren Zellen, ob Seit an Seit im Metropolenloft oder eingelassen in die Weite einer aufgelockerten Bürolandschaft mit Kaffee-Vollautomat und Schallschutz-Stellwänden – im Büro beschleicht einen, frei nach Jean-Jacques Rousseau, das Gefühl: ‚Der Mensch ist frei geboren, und liegt doch nine-to-five in Ketten.‘“
Je kühner Architektur-Avantgardisten und Management-Gurus die Perfektionierung des arbeitsteiligen Miteinanders auch vorantrieben – heraus komme immer nur eine weitere Mode der humanen Käfig- und Kleingruppenhaltung.
Fließband-Effizienz
Letztlich versteckt sich hinter den modernen Lichtsuppen-Fassaden die alte Ideologie des industriekapitalistischen Taylorismus, der auch die Büroabläufe auf Fließband-Effizienz trimmt. Was an Freiheiten im Bürokomplex zugelassen wird, sind reine Simulationsübungen, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten.
„Die Pauschalunterwerfung des Arbeitnehmers ist so groß wie eh und je“, bemerkt der Soziologe Dirk Baecker. Das dürfe man allerdings nicht mit einer Totalunterwerfung verwechseln. Innerhalb der so genannten Indifferenz-Zone sind Mitarbeiter bereit, Anweisungen zu befolgen, die der Arbeitsvertrag und die Stellenbeschreibung vorab nur zum Teil definieren können. „Die Details und Entwicklungen des täglichen Arbeitslebens sind umfangreicher und unbestimmter, als sie formal festgehalten werden können“, sagt Baecker. Diese Indifferenz-Zone, die Chester I. Barnard in der Blütezeit der Industrialisierung vor rund 80 Jahren definiert hat, sei heute wesentlich größer.
Die Anforderungen, sich außerhalb der eigenen Kompetenzen zu bewegen, seien deutlich gestiegen. Was Karl Marx so schön das „Engagement mit Haut und Haaren“ genannt hat, ist nach Aussagen von Baecker mittlerweile Realität. Das ist ein dauerndes Spiel zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer um die Frage, was der eine noch erwarten darf und der andere noch leisten kann. „Für dieses Spiel gibt es keine ethischen, moralischen, ethischen oder kulturellen Grenzen mehr“, führt Baecker aus.
Die BWL weiß wenig
Wo die Schmerzgrenze für Mitarbeiter liegt, kann niemand so genau sagen. Die BWL mit ihrem Kennzahlen-Fetischismus tut nur so, diese Kompetenz in der Steuerung zu haben. Es geht nach Meinung von Baecker nur darum, die Mitarbeiter soweit zu schonen, um sie schonungslos ausbeuten zu können. Was ist das Ergebnis dieser Gemengelage? Der Soziologe Niklas Luhmann hat Fragen dieser Art beantwortet, indem er darauf hinwies, dass in Organisationen typischerweise zwei Sprachen parallel gesprochen werden, eine offiziöse Sprache mehr oder minder leerer Floskeln und eine zynische Sprache der mehr oder minder folgenlosen Offenlegung dieser Floskeln.
Das sind die üblichen Schönwetter-Formulierungen des Managements die aus nicht ablehnungsfähigen positiven Vokabeln wie Ziel, Strategie, Innovation, Motivation, Kundenorientierung, Mitarbeiterbindung, Kollaboration oder offene Kommunikation bestehen. Sie können im Bullshit-Bingo der Unternehmensführung beliebig kombiniert werden. „Das kann so mit der Realität einer Organisation nicht übereinstimmen. Keine Organisation der Welt ist nur positiv.
Deshalb entsteht ein riesiger grauer oder gar schwarzer Bereich an nicht formulierten Negativeindrücken. Und die braucht ein Ventil und das ist der Zynismus“, so Baecker. Zynismus sei eine Form der extrem intelligenten Beobachtung. Der zynische Kommentar ist in der Regel der letzte Kommentar zu einem Sachverhalt. Vorher schaltet man auf den Modus „Dienst nach Vorschrift“, was nach Analysen von Gallup bei 70 Prozent der Beschäftigten der Fall sein soll.
„Der Zynismus ist die Form der Rede und die innere Kündigung ist die Form des Handelns“, konstatiert Baecker.
Knetmasse in Motivationsseminaren
Da helfen auch die mehr oder wenigen originellen Einfälle des Personalmanagements zur Erheiterung der Mitarbeiter nicht weiter. Etwa die „ganzheitlichen“ Konzepte, die in speziellen Motivationsseminaren eingeimpft werden. Die lieben Kolleginnen und Kollegen stellen sich im Kreis auf, greifen zum feuchten Händchen des Nachbarn und rufen im Chor: „Es beginnt ein kreativer Tag und ich fühle mich gut. Just great.“
Gestresste Mitarbeiter können ihren Frust in albernen Rollenspielen abbauen. Managementaufgaben werden danach mit Knetmasse nachgestellt, weil man ja alles etwas spielerischer angehen will. Meinen Ex-Kollegen von o.tel.o dürfte der erste Auftritt unseres neuen Chefs – nennen wir ihn Mister K. – noch gut in Erinnerung sein. Mit seinen Autoverkäufersprüchen brachte er in wenigen Minuten die Motivation der kompletten Kommunikationsabteilung auf eine Raumtemperatur von -20 Grad.
Wenn schöpferische Innovationen in holistischen Trauma-Bewältigungs-Workshops mit figurativen Knetgebilden nicht helfen, sollten es die karrierebewussten Büroarbeiter mit „Brainwriting“ probieren oder gleich die „Kaizen-Methode“ anwenden und danach ordentlich Teamgeist und ganz viel „Commitment“ entwickeln. „Synergien“ müssen am Schluss herauskommen, sonst leidet das „Shareholder-Value-Prinzip“.
Die Komik des Top-Managements
Die leeren Hurra-Plattitüden der Top-Manager überdecken nur die Realität einer bürokratischen Mikroherrschaft. Übrig bleibt eine höchst unfreiwillige Komik von Vorgesetzten, die sich mit dümmlichen Management-Phrasen über Wasser halten.
Zu bewundern in dem legendären Film „Office Space“ in der Rolle des Vorgesetzten Bill Lumbergh, der blöd grinsend mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und einem Becher Kaffee durch die Büroetagen stolpert, um Untergebene an das letzte Memo und die Pflicht zu erinnern, den TPS-Bericht mit einem Deckblatt zu versehen. Bei alldem ist es wohl egal, wie Arbeitsplätze gestaltet werden und wie viele Obstteller für Mitarbeiter zur Verfügung stehen.
Gerade im Kontext der kreativen und dienstleistungsgetriebenen Arbeitsinhalte ist es an der Zeit, sich von der lemminghaften Arbeitsorganisation zu verabschieden. Die Internet-Technologien ermöglichen nicht nur verteiltes und dezentrales Arbeiten, sondern Tätigkeiten, die sich nicht an der Präsenz eines Mitarbeiters, sondern am Arbeitsergebnis orientieren – ohne den Firlefanz von Motivationslehrgängen und Teambuilding-Maßnahmen am Hochseil des Siebengebirges.
Einen Anfang könnte man machen, wenn die Personalentwicklung in Unternehmen nicht mehr als Kostenfaktor, sondern als Investition verbucht wird, fordert Heiko Fischer von Resourceful Humans. Es reiche nicht aus, Organisationen nur auf Profit auszurichten: „Mir widerfuhr die traurige Ehre, dass ich nur drei Tage Personalchef von Groupon war und mit den Samwer-Brüdern zusammengearbeitet habe, bis ich mich mit einem dieser Typen so anlegte, dass ich in der Mittagspause gegangen bin“, erläutert Fischer.
Den Führungsstil solcher Karrieristen müsste man aufbrechen.
822 mal gelesen



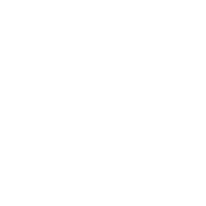

Sehr interessant!
„Für dieses Spiel gibt es keine ethischen, moralischen, ethischen oder kulturellen Grenzen mehr“, führt Baecker aus.
Ja, fast!
Natürlich gibt es diese Grenzen noch. Nur weiß niemand mehr so genau, wo sie verlaufen. Sie werden laufend getestet und geben sich nur zu erkennen, sobald sie überschritten werden; und dies auf beiden Seiten, auf Seiten derer, die sie überschreiten, und derer, deren Grenzen überschritten werden. „Woher soll ich wissen, was ich meine, bevor ich höre, was ich sage,“ fragt Karl Weck. Genau. Und woher soll ich wissen, wo eine Grenze verläuft, bevor ich sie überschreite? Es gibt sie nur im Modus ihrer instabilen Verschiebung.