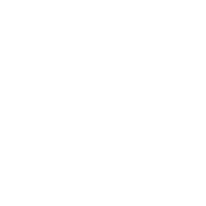Ulrich Klotz im Interview mit der Computerwoche zu zukünftigen Arbeitsweisen:
Wie wird das Internet unsere Arbeitswelt weiter verändern?
KLOTZ: Ohne die Bindung an Ort und Zeit werden viele Arbeiten zu einer Ware, die weltweit gehandelt werden kann. Was wir heute als „Outsourcing“, „Offshoring“ oder allgemeiner als „Globalisierung“ kennen, sind erst die Anfänge neuer Formen grenzenloser Arbeitsteilung, denn das Netz ermöglicht auch vollkommen neuartige Unternehmensmodelle.
Frage: Was meinen Sie damit?
KLOTZ: Ein Beispiel: Ein globaler IT-Konzern plant eine „Verflüssigung“ seiner Arbeitsstrukturen durch weitgehenden Verzicht auf festangestellte Mitarbeiter. Künftig sollen Projekte in kleine Arbeitspakete zerlegt und diese via Internet weltweit ausgeschrieben werden. Um diese globalen Minijobs kann sich jeder bewerben, auch die ehemaligen Angestellten des Konzerns. Die weltweit verstreuten Auftragnehmer kooperieren dann über das Internet in „Talent Clouds“. Bei dieser Art von „Crowdsourcing“ verschwindet nicht die Arbeit, aber der feste Arbeitsplatz. Dabei werden sozialpartnerschaftliche Modelle und nationalstaatliche Einwirkungsmöglichkeiten, etwa beim Arbeitsrecht, durch die Spielregeln privater Konzerne ersetzt. Ob das alles so funktionieren wird, sei dahingestellt. Auf jeden Fall sollten wir solche Entwicklungen sehr aufmerksam beobachten. Es ist klüger, sich beizeiten mit der Konstruktion von Brunnen zu befassen, als hinterher über die hineingefallenen Kinder zu jammern.
Koexistenz in einer Übergangsphase
Frage: Arbeit ohne Arbeitsplatz – ist das die neue Arbeit?
KLOTZ: Wir befinden uns in einer Übergangsphase, in der verschiedene Arbeitsformen und unterschiedliche Kulturen von Arbeit nebeneinander koexistieren. Die Situation ist ähnlich wie zu Beginn der Industrialisierung: Damals ließen neue Techniken wie Dampfmaschine, Eisenbahn oder später das Fließband ganz allmählich das entstehen, was wir heute als „Arbeit“ kennen – mit allem, was dazu gehört: Arbeitsplatz, Arbeitszeit, Arbeitsort, Ausbildungs- und Entlohnungsformen usw.
Frage: Und nun ist alles wieder auf Anfang?
KLOTZ: Seit dem Aufkommen der Computer in den siebziger Jahren wird Arbeit wiederum neu definiert: Immer mehr Menschen können überall und jederzeit arbeiten, dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeits- und Freizeit, zwischen Arbeits- und Wohnort, zwischen Arbeit und Lernen, zwischen Abhängigkeit und Selbständigkeit, zwischen Produzenten und Konsumenten. Arbeit bezeichnet wieder das, was man tut, nicht wohin man geht. Die Arbeitswelt wird vielfältiger, die Ausnahmen werden zur Regel, das „Normalarbeitsverhältnis“ und die „Normalbiografie“ sind auf dem Rückzug.
Frage: Und wie würden Sie das bewerten?
KLOTZ: Das alles ist zwiespältig, denn die aus den bürokratischen Unternehmenszwängen unfreiwillig Entlassenen werden oft zu Wander-Wissensarbeitern, denen die Fesseln neuer Freiheiten umgelegt werden: ein Höchstmaß an Eigenverantwortung und Selbstorganisation kombiniert mit minimalen Absicherungen und Planbarkeiten.
Das „Elektronengehirn“
Frage: Übernimmt also der Computer die Kopfarbeiten?
KLOTZ: Früher war vor allem in Gewerkschaftskreisen die Meinung verbreitet, dass diese Maschine – man sprach ja vom „Elektronengehirn“ – uns das Denken abnimmt. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Der Computer übernimmt Routinetätigkeiten und das Vorhersehbare – kurz gesagt: alles was planbar, regelhaft und programmierbar ist. Menschen werden dann vor allem noch für die Bewältigung von Ausnahmesituationen gebraucht.
Hierzu zählen allerdings auch viele Arbeiten, die gar nicht so einfach sind, wie es auf den ersten Blick scheint – zum Beispiel im Haushalt, im Gesundheitssektor, in der Pflege usw. Hingegen werden wir sehen, dass aufgrund der rapiden Fortschritte beim automatischen Verstehen menschlicher Sprache zahllose routinehafte Tätigkeiten etwa in Call-Centern, Banken, Versicherungen oder Anwaltskanzleien unter die Räder kommen.
Frage: Was tun wir dann in Zukunft, was bleibt übrig?
KLOTZ: Was immer hier oder dort an menschlicher Arbeit übrig bleibt, wird intellektuell anspruchsvoller, erfordert eine immer bessere Ausbildung und permanente Weiterbildung. Dies auch, weil infolge der Informatisierung vor allem die Informationsmenge exponentiell anwächst. Diese gigantische Lawine an Informationen und neuem Wissen kann man nur durch stärkere Spezialisierung bewältigen. Für diese Spezialisten hat der Management-Papst Peter F. Drucker vor gut fünfzig Jahren den Begriff „Wissensarbeiter“ geprägt. Ein Wissensarbeiter ist jemand, der mehr über seine Arbeit weiß, als jeder andere im Unternehmen. Ich behaupte, dass bei uns inzwischen die Mehrzahl der Menschen Wissensarbeiter sind, wir finden sie heute überall, egal ob im Blau- oder Weißkittel.
Hierarchisches Modell der Industrieära
Frage: Vor welchen Problemen stehen diese neuen Wissensarbeiter?
KLOTZ: Wissensarbeiter brauchen Strukturen, in denen sie ihr Know-how optimal mit dem anderer Spezialisten verbinden können. Tatsächlich arbeiten Wissensarbeiter aber meist in Organisationen, die noch immer vom hierarchischen Modell der Industrieära geprägt sind: oben wird entschieden, unten wird ausgeführt. Wissen ist aber nicht hierarchisch strukturiert, sondern situationsabhängig relevant oder irrelevant. Hier entsteht ein Dilemma: „die da oben“ entscheiden über Dinge, von denen sie meist weit weniger verstehen als „die da unten“. Die Folgen sind bekannt: Demotivation, Reibungsverluste, Fehlentscheidungen und Frust.
Entscheidungsträger glauben meist, sie wüssten etwas besser, weil sie eine bestimmte Position innehaben – das traf zu Taylors Zeiten vielleicht noch zu, ist aber heutzutage eher absurd. Die erschreckenden Ergebnisse von Umfragen über Arbeitszufriedenheit und Motivation sind eine direkte Folge der Tatsache, dass bei uns zu viele Manager noch immer an den hundert Jahre alten Konzepten eines Frederick Taylor festhalten, die im Zeitalter der Wissensarbeit schlichtweg kontraproduktiv sind.
Open-Source-Gemeinschaften
Frage: Wie sollte dann die neue Wissensarbeitswelt aussehen?
KLOTZ: Ein gutes Beispiel liefert die Welt der Open-Source-Gemeinschaften. Das sind weltweite Netzwerke freiwilliger Programmierer, die komplexe Projekte wie etwa Linux, Firefox oder Wikipedia oder auch wesentliche Teile des Internets realisieren. Die Menschen arbeiten in solchen Projekten mit hoher Motivation, oft Begeisterung – und das alles ohne Bezahlung. Warum tun sie das? Weil hier Menschen anders miteinander umgehen als in der hierarchisch-bürokratischen Arbeitswelt, denn hier basiert Wertschöpfung auf gegenseitiger Wertschätzung. Die Beteiligten arbeiten auf Augenhöhe miteinander, deshalb wird Wissen nicht als Herrschaftswissen missbraucht, sondern bereitwillig mit Anderen geteilt, daher auch der Name: Open Source = Offene Quelle. Anerkennung, Vertrauen, Respekt, Toleranz und Fairness sind hier nicht bloße Sonntagsreden, sondern gelebte Realität. Führungsfunktionen basieren auf Sachkompetenz und nicht auf formaler Autorität.
Im Netz zählt nicht das größere Büro, sondern die tatsächliche Leistung. Neue Ideen haben hier viel bessere Chancen als in den alten bürokratischen Strukturen. Deshalb sind viele Open-Source-Produkte der kommerziellen Konkurrenz oft schon nach kurzer Zeit voraus.
„Wissen ist Macht“
Frage: Warum setzen sich dann diese Ideen nur so langsam durch?
KLOTZ: Wo Organisationen noch auf dem alten Prinzip „Wissen ist Macht“ basieren, wird neues Wissen oft als Bedrohung empfunden und zunächst bekämpft. Zwar wird überall von Innovation geredet, aber wirkliche Veränderungen sind oft gar nicht gewollt – das habe ich im Verlauf meiner Berufstätigkeit sehr häufig erlebt. Innovationen sind Bottom-up-Prozesse, die sich mit Top-down-Strukturen nun einmal schlecht vertragen. In den klassisch hierarchischen Organisationspyramiden – oben die Würdenträger, unten die Innovationsträger und dazwischen jede Menge Bedenkenträger – ist Loyalität wichtiger als Leistung. Den Entscheidungsträgern geht es zuerst um Machterhalt und danach um Inhalte, da können Ideen noch so gut sein.
Wo bevorzugt pflegeleichte Ja-Sager Karriere machen und Opportunismus als Qualifikationsersatz dient, gibt es kaum noch Weiterentwicklung, weil andere Meinungen – und neue Ideen sind anfänglich stets Minderheitenmeinung – keine Fürsprecher mehr finden. Aus diesem Grund wurden schon zahllose Firmen, ja ganze Branchen, Opfer ihrer internen Strukturen und Innovationsbremsen – wie zum Beispiel die gesamte deutsche Computerindustrie, die Unterhaltungselektronik, die Fotoindustrie und einiges mehr.
Lösung?
Frage: Wie sieht ihr Lösungsvorschlag aus?
KLOTZ: Mich treibt die Frage um, wie wir endlich die innovationsfeindlichen Kommandostrukturen der Industriegesellschaft überwinden können – hin zu einer Arbeitskultur, die von gegenseitiger Wertschätzung, Respekt und Toleranz geprägt ist. Von den Open-Source-Communities können wir eine Menge über zeitgemäße Arbeitsgestaltung lernen. Die junge Generation, die mit Wikis, Blogs und Social Networks groß geworden ist, lebt ohnehin eine neue Kultur des Wissensaustausches. Viele dieser „Digital Natives“ werden sich nicht mehr in eine graue Sachbearbeiter-Welt einsperren lassen, wo sie zwischen Karriereleitern, Gehaltsgittern, Planstellen und Dienstwegen viel Zeit und Energien mit internen Machtspielen vergeuden.
Unsere Unternehmen werden von diesen Internet-Communities lernen müssen, weil sie andernfalls diese Generation nicht als kreative Mitarbeiter werden gewinnen oder halten können. Natürlich wird unsere Welt keine Open-Source-Welt werden. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich intelligentere Formen der Zusammenarbeit und offene Innovationskulturen langfristig durchsetzen und künftig zu einem neuen Verständnis von Arbeit führen werden. Unternehmen, die hingegen zu lange an den überkommenen Arbeitsstrukturen der Industrieära festhalten, werden aufgrund ihrer internen Innovationsbarrieren untergehen.
Wandel in der Gesellschaft
Frage: Wie weitreichend sind diese Veränderungen?
KLOTZ: Wenn sich Kommunikationsformen ändern, wandelt sich das Fundament einer Gesellschaft. Wenn sich die Art und Weise verändert, wie Menschen ihre Fähigkeiten verbinden und weiterentwickeln, wirkt sich das auf jeden Aspekt unseres Denkens aus: Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache, Vorstellungsvermögen, Kreativität, Urteilskraft, Entscheidungsprozesse.
In der neuen Gesellschaft wird nicht nur Arbeit neu definiert. Auch das Bild des Menschen wandelt sich. Wenn Menschen nicht mehr wie Maschinenteile arbeiten müssen, dann zählt das, was uns von Maschinen unterscheidet: Kreativität, Emotionen und Intuition. Menschen können Informationen in Bedeutung und Erfahrungen in Wissen verwandeln, das kann man Computern (noch?) nicht beibringen – wie auch unsere Fähigkeit, intelligent mit Unvorhersehbarem umzugehen. Weil wir künftig mehr kreative Individuen brauchen als brave, angepasste Ausführer, müssen wir vor allem unser industriegeprägtes Bildungssystem radikal umkrempeln. Fleiß, Ausdauer und das Erlernen von Fertigkeiten allein reichen nicht mehr, denn irgendwo wird irgendwer immer noch fleißiger sein. Im Wettbewerb von morgen zählen vor allem gute Ideen.
Hier ist Eile geboten, denn die soziale Kluft zwischen den Gewinnern und Verlierern dieses Strukturwandels wird immer größer. Die zunehmende Spreizung bei den Einkommen ist eine direkte Folge der Informatisierung in der Arbeitswelt. Kolonnenhafte Vervielfältigungsarbeiten werden mehr und mehr technisiert und / oder in andere Länder verlagert. Auf der anderen Seite werden kreative Unikat-Arbeiten immer bedeutsamer und besser bezahlt, hier ist das Einkommen aber oft nicht mehr an Arbeitszeit usw. gekoppelt. Denken wir an einen Romanautor: um erfolgreich zu sein, kommt es nicht darauf an wie schnell er wie viele Zeilen schreibt, sondern wie gut seine Ideen sind. Ideen von heute sind das Geld von morgen. Bei allen Gütern, die man digitalisieren kann, zählt nur die Idee, das Design, die Entwicklung usw. – also ein Unikat. Die Vervielfältigung und weltweite Verteilung des Endprodukts, also das, was heute noch Industriearbeit ist, übernimmt die Technik.
Das Ende
Frage: Ist das das Ende der Industriegesellschaft?
KLOTZ: Die Produktion materieller Güter wird natürlich nicht verschwinden, genauso wenig wie die Landwirtschaft beim Übergang zur Industriegesellschaft verschwand. Doch in allen hochentwickelten Ländern wird Innovation und Wertschöpfung mit immateriellen, digitalisierbaren Geistesprodukten immer wichtiger. Das gilt auch bei Industrieprodukten – bei Mobiltelefonen aber etwa auch bei Autos kommt es mehr und mehr auf die Qualität der Software und des Designs an, um erfolgreich zu sein. Wer auf diesen Feldern nicht ganz vorne mitspielen kann, wird auch bei der Produktion von materiellen Gütern existenzielle Probleme kriegen.
Wir Europäer müssen deshalb verdammt aufpassen, um nicht im Zangengriff zwischen innovativen US High-Tech-Konzernen und nachrückenden asiatischen Massenproduzenten zerquetscht zu werden. Dafür müssen wir den Ideenreichtum der gesamten Gesellschaft zur Entfaltung bringen. In unserer starren Arbeitswelt liegen viele Fähigkeiten brach, weil bei uns Menschen oft nicht das tun dürfen, was sie können und wollen. Wir vergeuden heute viel mehr menschliche Potenziale als wir tatsächlich nutzen. Diese Verschwendung können wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben.
Anmerkung der Redaktion:
Das Interview wurde 2014 von Hans Königes von der Computerwoche (Text-Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0 creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0) geführt; die Langfassung finden Sie hier sowie weitere Informationen zu Ulrich Klotz im Kontext des Interviews hier .
Bereits 1999/2000 schrieb Ulrich Klotz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine Serie genau zu diesem Thema. Die Inhalte haben an Aktualität seitdem nichts eingebüßt!
1499 mal gelesen